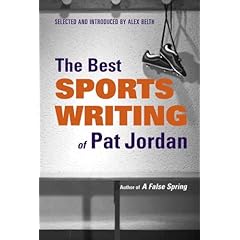 Der amerikanische Journalist Pat Jordan ist ein guter Schreiber. Wenn auch einer, der zunehmend mit den Macken der Zunft hadert. Was nicht nur an seinem Alter liegen kann. Eher schon an seinen Idealvorstellungen von einer Welt, in der Magazinautoren viel Geld dafür bekamen, relativ wenig zu schreiben, und bei ihren Ausflügen in den Alltag des Profisports viel Zeit zugestanden und alle Spesen erstattet bekamen. Das funktionierte solange wie Magazine wie Sports Illustrated mit ihren langen Porträts das Image von Athleten nachhaltig geprägt haben und stark und unabhängig auftraten und sich Autoren suchten, die Lesestoff ablieferten, dem man anderswo nicht finden konnte.
Der amerikanische Journalist Pat Jordan ist ein guter Schreiber. Wenn auch einer, der zunehmend mit den Macken der Zunft hadert. Was nicht nur an seinem Alter liegen kann. Eher schon an seinen Idealvorstellungen von einer Welt, in der Magazinautoren viel Geld dafür bekamen, relativ wenig zu schreiben, und bei ihren Ausflügen in den Alltag des Profisports viel Zeit zugestanden und alle Spesen erstattet bekamen. Das funktionierte solange wie Magazine wie Sports Illustrated mit ihren langen Porträts das Image von Athleten nachhaltig geprägt haben und stark und unabhängig auftraten und sich Autoren suchten, die Lesestoff ablieferten, dem man anderswo nicht finden konnte.In Deutschland hat man dieses Paradies nur ein paar Jahre gehabt. Damals, als das Monatsmagazin Sports existierte und seinen Lesern eine ungewöhnliche Wundertüte aus Reportagefotografie und abgelegeneren Themen servierte. Es war wirtschaftlich nie tragfähig und wanderte irgendwann auf den Zeitschriftenfriedhof. In den USA hingegen enstand im Magazinsektor eine ganze Ära, die obendrein noch ein anderes Medium belebte: Sportswriting in Buchform - die Idolisierung von Athleten zu kulturellen Meilenstein durch das gedruckte Wort.
Aus der Halbdistanz konnte man so etwas einfach nur bewundern. Genauso wie man es bedauert, wenn es sich überlebt und nur noch ein paar sentimentale Gedanken abwirft, die der besagte und begabte Pat Jordan jetzt in Slate abgeliefert hat. Sein Fazit: das Fernsehen hat die Athleten zu einer Art von Hollywood-Stars gemacht, weil es einerseits die extrem hohen Gehälter finanziert und andererseits durch seine Quickie-Interview-Kultur die Aktiven in dem Gefühl bestärkt: Es gibt nur ein relevantes Medium. Die vielen Jungs von der Print-Karawane sind nur Schmeißfliegen oder Kamele. Ihrer Kunst misst niemand mehr einen besonderen Wert zu.
Mal abgesehen von der Sentimentalität, die solche Entwicklungen bei jenen auslösen, die sich gerne daran erinnern, dass alles mal viel schöner und besser war: Jordan hat mit seinem Blues ungewollt eine Erklärung dafür geliefert, weshalb Sportblogs so populär sind. Tatsächlich hat das geschriebene (vormals gedruckte) Wort nämlich überhaupt nicht seine Bedeutung im Kontext des Medienalltags verloren. Es kommt einfach ohne direkten Zugang zu den nicht mehr zugänglichen Sportlern daher. Es entsteht in den Köpfen der Leute, die sich ihren Teil denken, wenn sie Fernsehübertragungen und Nachrichten verfolgen. Und es hält sich nicht auf mit dem Problem, dass man Spiele live in der Arena sehen muss, wo sie doch im Fernsehen viel informativer abgehandelt werden. Es ist auch keine ausgiebige, langwierige, analytische Betrachtungshaltung mehr, die sich darum bemüht, eine ohnehin nur beschränkte Zahl von Archetypen des Sports so hautnah wie möglich zu beschreiben (Archetypen wie den Sieger, den Verlierer, den Aufsteiger, den Comeback-Meister, den Durchgeknallten, den Philosophen oder den Clown). Sondern es handelt sich um spontane, improvisierte, vergnügte, inspirierte Einmischung. Eine, die sich im optimalen Fall schamlos und rücksichtslos über diese Einschränkungen hinwegsetzt, über die ein Mann wie Pat Jordan zu Recht klagt: Dass man nicht mehr an die Stars herankommt (wie früher). Und dass sie einem wenn überhaupt, nur wenig Zeit schenken.
Zu diesem Thema wird es sicher immer mal wieder etwas zu Schreiben geben. Für heute sollte der Hinweis auf den Jordan-Text genügen (via The Big Lead). Über Jordan kann man natürlich auch etwas lesen, nämlich hier.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen