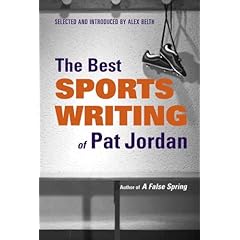Einem dankenswerten Hinweis von
nolookpass folgend, habe ich gerade die beiden empfohlenen Texte von Henning Sussebach gelesen. Bei denen handelt es sich rein vordergründig um zwei sehr bemerkenswerte Versuche, die Seelenlandschaft eines Torwarts zu vermessen. Tatsächlich, so stellt sich heraus, offenbart die Arbeit von Sussebach etwas sehr viel Interessanteres: Den Stand der Dinge im Verhältnis deutscher Printmedien zu Interviewpartnern von einem gewissen gesellschaftlichen Kaliber. Sie haben Angst. Sie knicken ein. Sie machen sich zu Handlangern einer Propaganda-Industrie, die ohne ihre liebedienerischen Bemühungen gar nicht existieren würde. Sussebach hat damals noch ganz gut beackert,
das aufgepfropfte Dilemma, für das er nichts konnte. "Jede Zeile ist mit dem Rechtsanwalt der
ZEIT abgestimmt", schrieb er, ehe er uns ein Interview präsentierte, das nur seine Fragen publizierte. Das Drucken der Antworten hatte sich Oliver Kahn verbeten.
In welchem Gesetz in Deutschland steht eigentlich, dass ein Gesprächspartner das Recht hat, die Aufzeichnungen eines Medienarbeiters vor Veröffentlichung gegenzulesen? Gegebenfalls zu verändern? Oder gar rechtsverbindlich zu erklären: "Ja, doch, es sei so geredet worden, wie es nun aufgeschrieben sei, alles authentisch, nur dürfe das niemand lesen. Nicht vor seinem Karriereende, das müsse man verstehen"?
Man muss vielleicht mal darauf aufmerksam machen, dass es so etwas in Ländern wie den USA oder Großbritannien nicht gibt. Dieses Abstimmen und Autorisieren von Gesprächen im Print-Journalismus. Gesagt ist gesagt. Man teilt schon mal hin und wieder ein paar Sätze und Gedanken "
off the record" mit und kann und darf erwarten, dass der Journalist das nicht verwendet. Man bekommt manchmal Informationen auch nur
"on background" oder
"deep backgrund". Aber das heißt nur, dass man im Falle des Zitierens die redende Person so verschleiern muss, dass niemand die wahre Identität erkennen kann. Das Protokoll eines kompletten Gesprächs blockiert niemand.
Buyer's remorse geht auf die Kappe des Befragten nicht auf Kosten der Leser einer Publikation, deren verdammte Aufgabe es sein sollte, das aufgesetzte Antlitz eines Selbstdarstellers abzuarbeiten und dahinter zu schauen.
Es geht bei diesem Thema gar nicht um diesen Einzelfall, zumal Sussebach nach Kräften Öffentlichkeit hergestellt und den Fall, so gut es ging, transparent gemacht hat. Tatsächlich häufen sich die Eingriffe wie man an Diskussionen in Medienblogs wie dem von
Stefan Niggemeier erkennen kann. Hier ein anderes Beispiel im Nachklang eines spektakulären Interviewfalls: Reporter interviewt Geiselnehmer per Telefon in der Bank. Kuriosität am Rande: Der Reporter selbst will hinterher sein Gespräch mit einem Medienvertreter nicht autorisieren, während er vermutlich den Geiselnehmer nie um so etwas gebeten hätte.
Die Meinungsbeiträge
auf dieser Seite der Akademie für Publizistik in Hamburg zeigen, wie weit die Kotau-Gesellschaft vorangeschritten ist. Große hohle Worte wie Medien-Ethik flattern da herum, um ein Verhalten zu rechtfertigen, dass in der Konsequenz die Grundsätze der Medienarbeit aushöhlt. Eine der merkwürdigsten Gedankenansätze zu diesem Thema ist die Behauptung von Bernhard Debatin, es gebe ein "Gebot der Autorisierung von Interviews (Pressekodex Ziffer 2)". Den
Pressekodex, aufgestellt vom Presserat, kann jeder selber nachlesen. Da steht das blanke Gegenteil: "Zur Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt noch verfälscht werden." Sie werden aber entstellt und verfälscht, wenn Gesprächspartner hinterher entscheiden können, ob ihre Aussagen veröffentlicht werden dürfen oder nicht. Mit anderen Worten: Wem etwas an der Wahrheit liegt, der lässt keine Interviews autorisieren. Woraus sich zwingend ergibt, dass er nicht vorher sein Recht auf freie Berichterstattung freiwillig aufgibt und vorab einer Autorisierung zustimmt.
Mehr dazu in den Richtlinien.Wer jetzt noch Lust auf das
zweite, aktuelle Stück von Sussebach verspürt, sollte es ebenfalls lesen. Und vielleicht auch mal mit dem ersten vergleichen. Und überlegen, wieviel Aufwand ein Autor treiben muss, der einst an die Kandarre genommen wurde, um am Ende einen so uninteressanten Menschen wie Oliver Kahn zu porträtieren. Und was unterm Strich herauskommt. "Aber die Leere, die dann kommt, die muss ich aushalten lernen.", hatte der Torwart über die Zeit nach dem Ende seiner Karriere gesagt. Zapperlot, wie tief.
 Die Staatsanwaltschaft in Florida kommt offensichtlich in ihrem Fall ebenfalls voran. Nachdem vor zwei Wochen ein fünfter Verdächtigter rund um Einbruch in das Haus von Washington-Redskins Safety Sean Taylor angeklagt wurde, gab der erste der Gruppe seine Mittäterschaft zu. Taylor hatte die Einbrecher überrascht und war einen Tag nach der Attacke an den Folgen einer Schussverletzung gestorben. Der geständige Venjah Hunte (Bild), hat 29 Jahre Gefängnis erhalten und hat zugesichert, den Anklagevertretern bei ihrer Prozessen gegen die restlichen Mitglieder der Gang behilflich zu sein. Das könnte bedeuten, das das Verfahren hinreichend belastende Aussagen produziert und die eine oder andere Todesstrafe obendrein. In Florida wird die Tat als Mord (first-degree murder) eingestuft. Alle Mitschuldigen gelten als gleichwertig involviert, unabhängig davon, wer die Schusswaffe besaß und wer gefeuert hat und welche Umstände bei den Ereignissen eine Rolle spielten. Nach deutschem Rechtsverständnis würde das Geschehen vermutlich als Körperverletzung mit Todesfolge behandelt (Paragraph 227 Strafgesetzbuch) und nicht als Mord (Paragraph 211). Das liegt an einer weitaus differenzierten Betrachtungsweise im deutschen Rechtsverständnis in der Bewertung von schweren Straftaten.
Die Staatsanwaltschaft in Florida kommt offensichtlich in ihrem Fall ebenfalls voran. Nachdem vor zwei Wochen ein fünfter Verdächtigter rund um Einbruch in das Haus von Washington-Redskins Safety Sean Taylor angeklagt wurde, gab der erste der Gruppe seine Mittäterschaft zu. Taylor hatte die Einbrecher überrascht und war einen Tag nach der Attacke an den Folgen einer Schussverletzung gestorben. Der geständige Venjah Hunte (Bild), hat 29 Jahre Gefängnis erhalten und hat zugesichert, den Anklagevertretern bei ihrer Prozessen gegen die restlichen Mitglieder der Gang behilflich zu sein. Das könnte bedeuten, das das Verfahren hinreichend belastende Aussagen produziert und die eine oder andere Todesstrafe obendrein. In Florida wird die Tat als Mord (first-degree murder) eingestuft. Alle Mitschuldigen gelten als gleichwertig involviert, unabhängig davon, wer die Schusswaffe besaß und wer gefeuert hat und welche Umstände bei den Ereignissen eine Rolle spielten. Nach deutschem Rechtsverständnis würde das Geschehen vermutlich als Körperverletzung mit Todesfolge behandelt (Paragraph 227 Strafgesetzbuch) und nicht als Mord (Paragraph 211). Das liegt an einer weitaus differenzierten Betrachtungsweise im deutschen Rechtsverständnis in der Bewertung von schweren Straftaten.